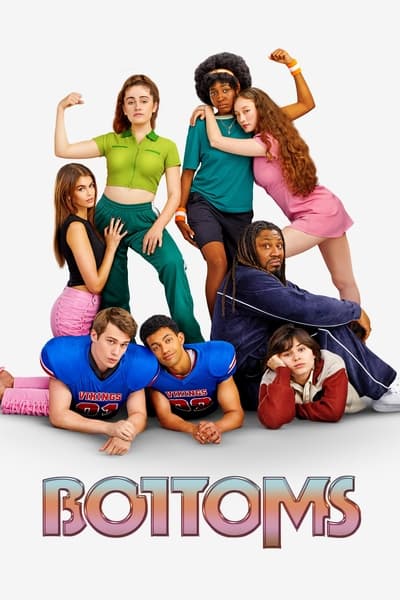Little.Man.2006.GERMAN.DL.720p.WEB.H264.iNTERNAL.-.SunDry
Dienstag, 14. November 2023 19:21
Der kleinwüchsige Juwelendieb Calvin Sims verbrachte mehrere Jahre im Gefängnis. Er will mit den Diebstählen aufhören, sein Chef Walken bietet ihm 100.000 Dollar für das Stehlen des Queen Diamonds an. Zusammen mit seinem Partner Percy klappt der Diebstahl, doch durch ein Missgeschick nimmt die Polizei die Verfolgung auf. Calvin versteckt daraufhin den Diamanten in der Tasche von Vanessa Edwards, die Calvin zufällig bei der Flucht in einem Einkaufsladen begegnet.

Dauer: 97 Min | Format: mkv | Größe: 2555 MB | IMDb: Little Man | YouTube | xRel
Download: Usenet (schneller & anonym mit gratis Testphase)
Download: ddownload.com
Mirror #1: rapidgator.net
Passwort: ohne Passwort
Thema: Komödie, Low HD - 720p | Kommentare (0) | Autor: Krul